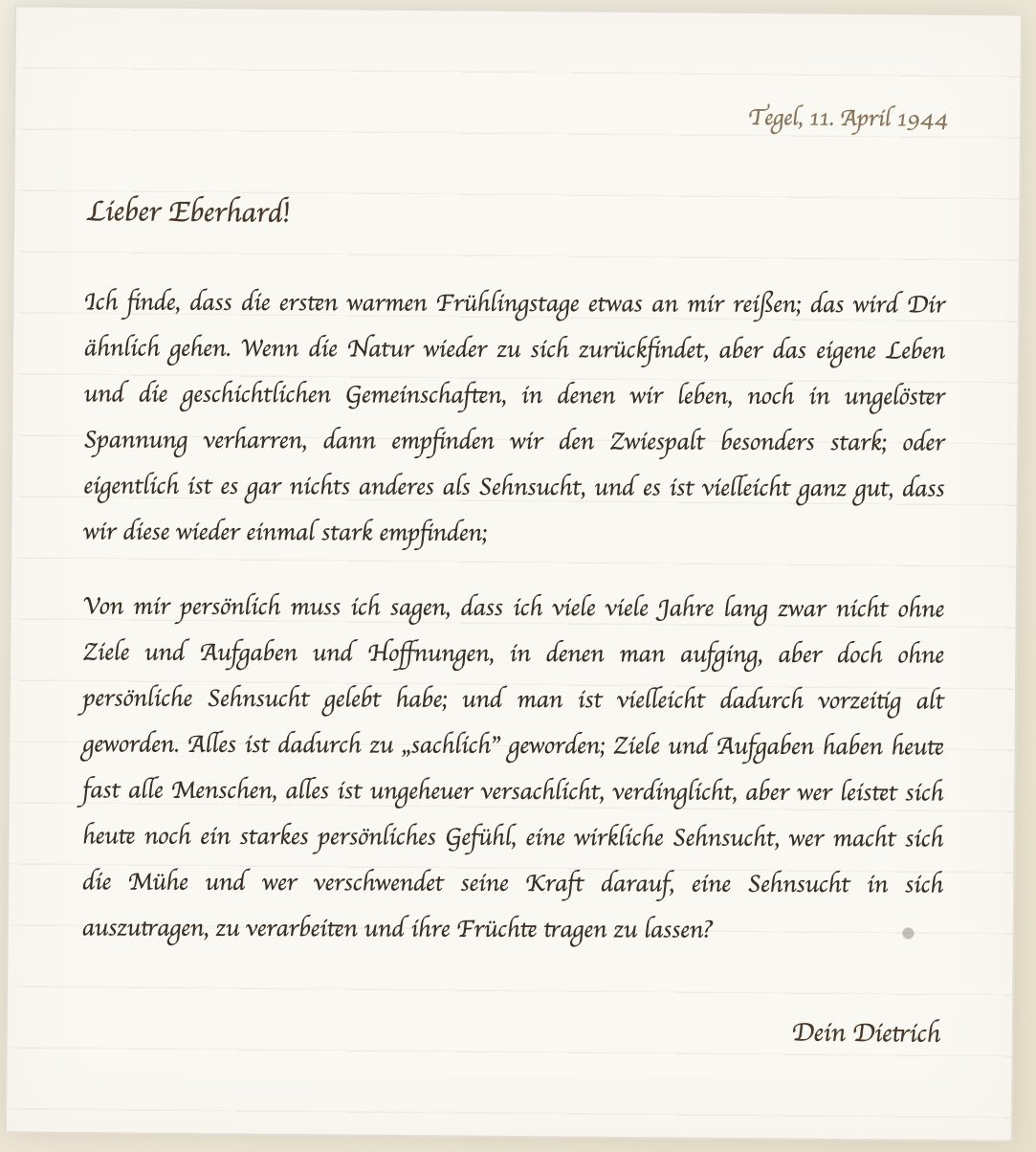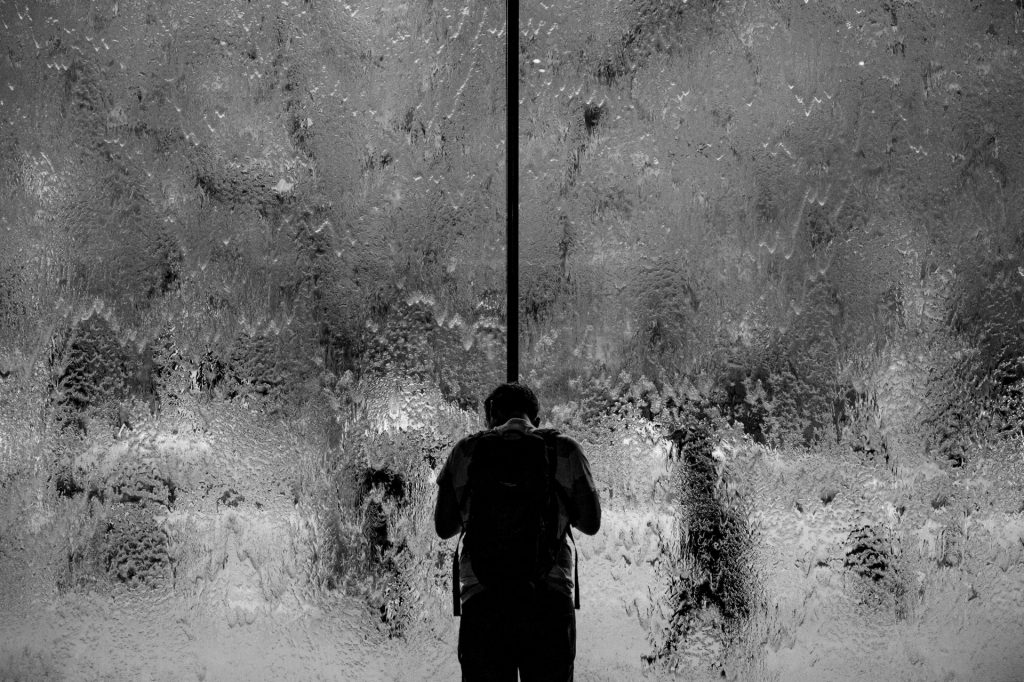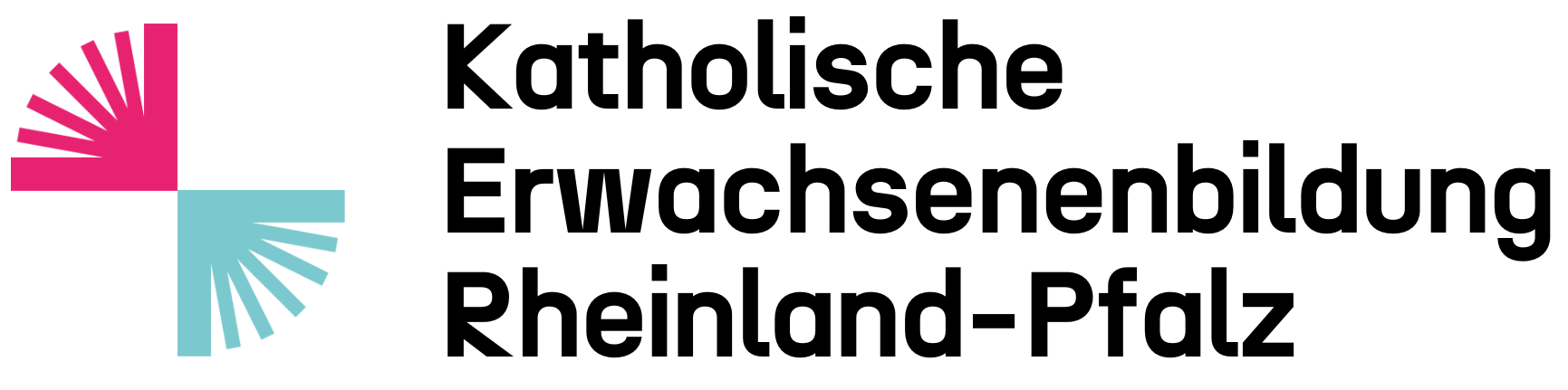Ein 81 Jahre alter Brief als Kompass für die heutige Zeit? Am 11. April 1944 schreibt Dietrich Bonhoeffer aus dem Gefängnis Tegel an seinen Freund Eberhard Bethge. Die gedanken, die er dort zur über Sehnsucht teilt, wirkt heute erstaunlich aktuell. In diesem Brief entwickelt der von den Nationalsozialisten inhaftierte und ermordete Theologe und Widerstandskämpfer eine Analyse der Sehnsucht, die weit über das Private hinausgeht und politische Folgen hat
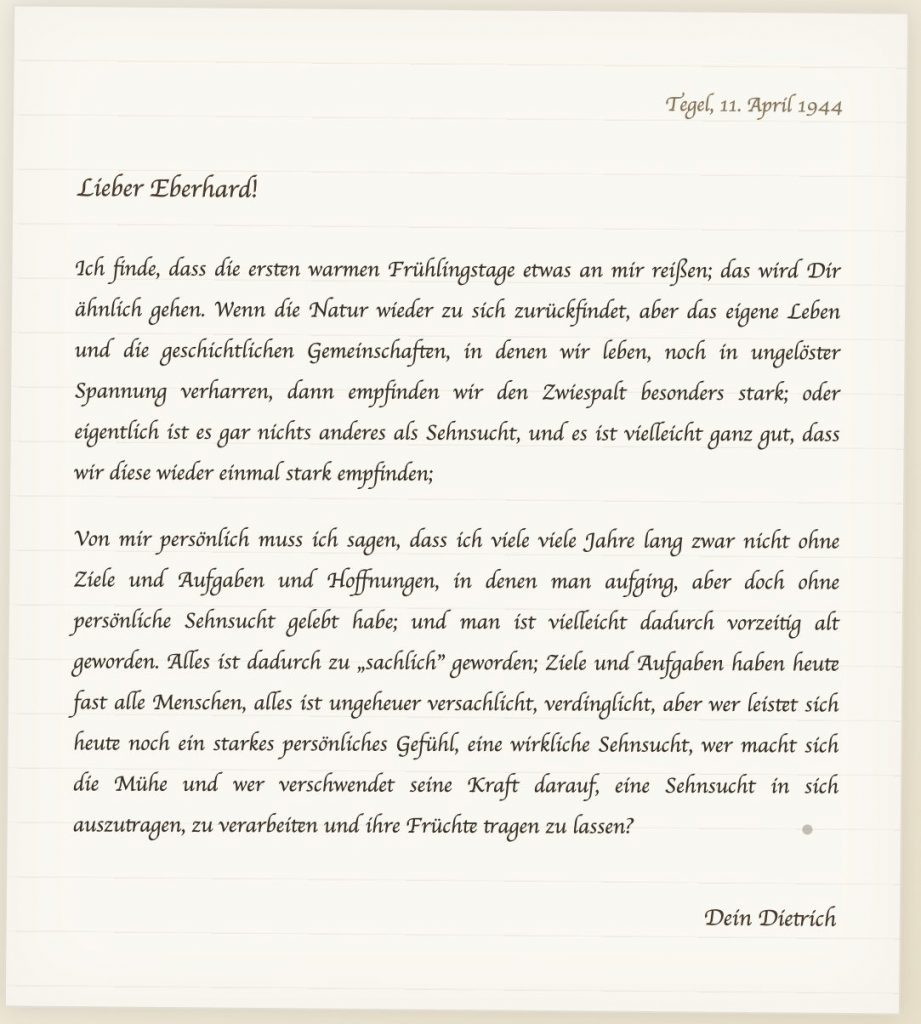
Bonhoeffer beschreibt seine Empfinden wie folgt: „Ich finde, dass die ersten warmen Frühlingstage etwas an mir reißen, das wird Dir ähnlich gehen. Wenn die Natur wieder zu sich zurückfindet, aber das eigene Leben und die geschichtlichen Gemeinschaften, in denen wir leben, noch in ungelöster Spannung verharren, dann empfinden wir den Zwiespalt besonders stark.“
Diese Spannung zwischen natürlicher Erneuerung und gesellschaftlicher Stagnation wird für Bonhoeffer zum Ausgangspunkt einer tieferen Analyse. Er stellt fest: „eigentlich ist es gar nichts anderes als Sehnsucht, und es ist vielleicht ganz gut, dass wir diese wieder einmal stark empfinden.“
Zentral ist dabei seine weitere Ausführung: „aber wer leistet sich heute noch ein starkes persönliches Gefühl, eine wirkliche Sehnsucht, wer macht sich die Mühe und wer verschwendet seine Kraft darauf, eine Sehnsucht in sich auszutragen, zu verarbeiten und ihre Früchte tragen zu lassen?“
Bonhoeffer diagnostiziert eine systematische Verdrängung der Sehnsucht in seiner Zeit: „von mir persönlich muss ich sagen, dass ich viele viele Jahre lang zwar nicht ohne Ziele und Aufgaben und Hoffnungen, in denen man aufging, aber doch ohne persönliche Sehnsucht gelebt habe; und man ist vielleicht dadurch vorzeitig alt geworden.“
Seine Gesellschaftsanalyse aus dem Jahr 1944 ist verblüffend aktuell: „Alles ist dadurch zu ’sachlich‘ geworden; Ziele und Aufgaben haben heute fast alle Menschen, alles ist ungeheuer versachlicht, verdingicht.“ Das scheint gut in unsere heutige Zeit zu passen.
Der Prozess der Versachlingung beschreibt die Tendenz, soziale, emotionale oder persönliche Phänomene auf rationale, objektive und oft technokratische Weise zu reduzieren. In der modernen Gesellschaft führt Versachlichung dazu, dass komplexe menschliche Beziehungen, Gefühle und Bedürfnisse –auch Sehnsüchte – zunehmend als messbare, kontrollierbare oder funktionale Größen betrachtet werden. Während Verdinglichung die Umwandlung von sozialen Beziehungen, menschlichen Eigenschaften oder kulturellen Bedeutungen in „Dinge“ oder Objekte beschreibt. In der heutigen Zeit zeigt sich Verdinglichung etwa darin, dass Menschen und ihre Bedürfnisse zunehmend als Ressourcen, Datenpunkte oder Konsumobjekte behandelt werden. Dies kann zu einer Entmenschlichung führen, bei der die individuelle Verletzlichkeit und die Sehnsucht nach Anerkennung und Zugehörigkeit übersehen oder marginalisiert werden.
Bonhoeffers Aussagen zur Sehnsucht verweisen zudem auf drei wichtige Aspekte:
Sehnsucht als gesellschaftliches Problem: In einer „versachlichten“ Gesellschaft wird Sehnsucht als Luxus oder Verschwendung betrachtet. Sie passt nicht in effiziente Systeme und wird systematisch verdrängt.
Sehnsucht als Arbeit: Bonhoeffer spricht von „Mühe“ und „Kraft“, die nötig sind, um Sehnsucht zu kultivieren. Sie ist kein passives Gefühl, sondern erfordert aktive Gestaltung und bewusste Entscheidung.
Sehnsucht als produktive Kraft: Die Metapher der „Früchte“ zeigt, dass Sehnsucht Ergebnisse hervorbringen soll. Sie ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur gesellschaftlichen Veränderung.
Sehnsucht als Widerstandsform
Bonhoeffers Kontext als politischer Gefangener des NS-Regimes macht deutlich: Seine Reflexion über Sehnsucht ist kein romantisches Konzept, sondern eine Form des Widerstands gegen ein entmenschlichendes System. Die Weigerung, sich der „Versachlichung“ zu unterwerfen, wird zu einem politischen Akt.
Sehnsucht bewahrt die Vorstellung alternativer Möglichkeiten und weigert sich, das Bestehende als unveränderlich zu akzeptieren. Sie hält die Vision einer anderen Gesellschaft lebendig und motiviert zum Handeln. In diesem Sinne wird Sehnsucht zu einer subversiven Kraft, die die Autorität des Status quo untergräbt.
Kollektive Sehnsucht und gesellschaftliche Transformation
Bonhoeffer unterscheidet zwischen persönlicher Sehnsucht und der Sehnsucht nach „geschichtlichen Gemeinschaften“. Diese Unterscheidung ist politisch hochrelevant: Es geht nicht nur um individuelle Erfüllung, sondern um gesellschaftliche Transformation.
Die Sehnsucht nach anderen Formen des Zusammenlebens, nach gerechteren Strukturen, nach einer humaneren Gesellschaft wird zur Triebkraft politischen Handelns. Politische Bewegungen leben von dieser kollektiven Sehnsucht nach Veränderung. Klimaproteste, Bürgerrechtsbewegungen, soziale Initiativen entstehen aus der Sehnsucht nach einer anderen Welt.
Sehnsucht als Gegenkraft zur politischen Resignation
In einer Zeit, die oft von politischer Resignation und Zynismus geprägt ist, wird Sehnsucht zu einer wichtigen Gegenkraft. Sie ermöglicht es Menschen, nicht nur passive Konsumenten medialer Inhalte zu sein, sondern aktiv gesellschaftliche Entwicklungen mitzugestalten.
Angesichts des politischen Rechtsrucks in vielen europäischen Ländern und der Zunahme autoritärer Tendenzen muss Sehnsucht als demokratische Ressource verstanden werden. Sie hält die Vorstellung einer offenen, pluralen Gesellschaft lebendig und motiviert zur politischen Partizipation.
Sehnsucht als Bildungsaufgabe
Bonhoeffers Überlegungen haben unmittelbare Relevanz für die Erwachsenenbildung. Bildung, die nur auf ökonomische Verwertbarkeit zielt, greift zu kurz. Eine Bildung, die Sehnsucht kultiviert und „ihre Früchte tragen lässt“, ermöglicht Menschen, ihre Umwelt kritisch zu hinterfragen und aktiv zu gestalten.
Dies entspricht Paulo Freires Verständnis von Bildung als „Weltverstehen und Weltgestalten“. Bildung wird so zu einem Prozess der Emanzipation, der Menschen dazu befähigt, nicht nur zu funktionieren, sondern gesellschaftliche Verhältnisse mitzugestalten.
Strukturelle Verankerung der Sehnsucht
Die Herausforderung besteht darin, Sehnsucht nicht der Beliebigkeit zu überlassen, sondern sie strukturell zu verankern. Das bedeutet:
- Bildungsräume schaffen, in denen Sehnsucht artikuliert und entwickelt werden kann
- Politische Partizipationsformen entwickeln, die über reine Funktionalität hinausgehen
- Gesellschaftliche Diskurse fördern, die alternative Zukunftsvorstellungen ernst nehmen
- Widerstand gegen die weitere „Versachlichung“ aller Lebensbereiche
Fazit
Dietrich Bonhoeffers Brief aus dem Gefängnis Tegel zeigt Sehnsucht als politische Kategorie auf. In einer „versachlichten“ Welt wird sie zur Widerstandskraft gegen Entmenschlichung. Sie bewahrt die Möglichkeit des Wandels und motiviert zu politischem Handeln.
Die Analyse Bonhoeffers bleibt hochaktuell: Gesellschaften brauchen Menschen, die bereit sind, Sehnsucht zu kultivieren und in politische Veränderung umzusetzen. Ohne diese Bereitschaft drohen sie in Stillstand und Resignation zu verharren. Sehnsucht ist kein Luxus, sondern eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Sie ist Teil jener „gelebten Praxis der Hoffnung“, die Bonhoeffer in seinem Widerstand gegen das NS-Regime verkörperte und die heute mehr denn je gebraucht wird.
Referenzen
Feil, E., Gremmels, C., Huber, W., Pfeifer, H., Schönherr, A., Tödt, H. E., & Tödt, I. (1998). Dietrich Bonhoeffer Werke. E. Bethge (Ed.). Kaiser.