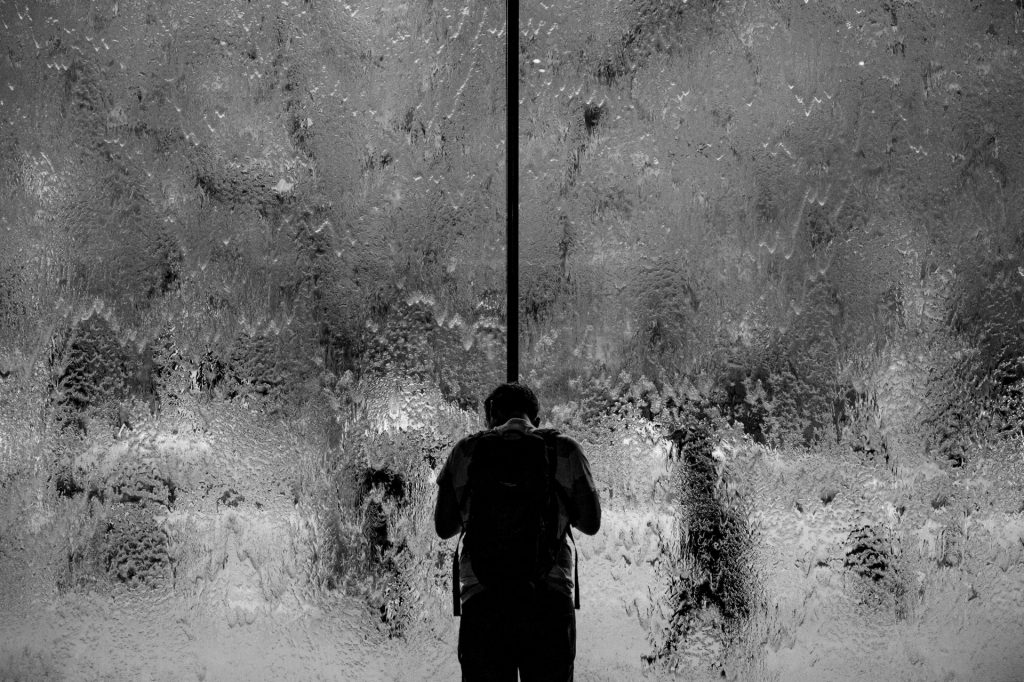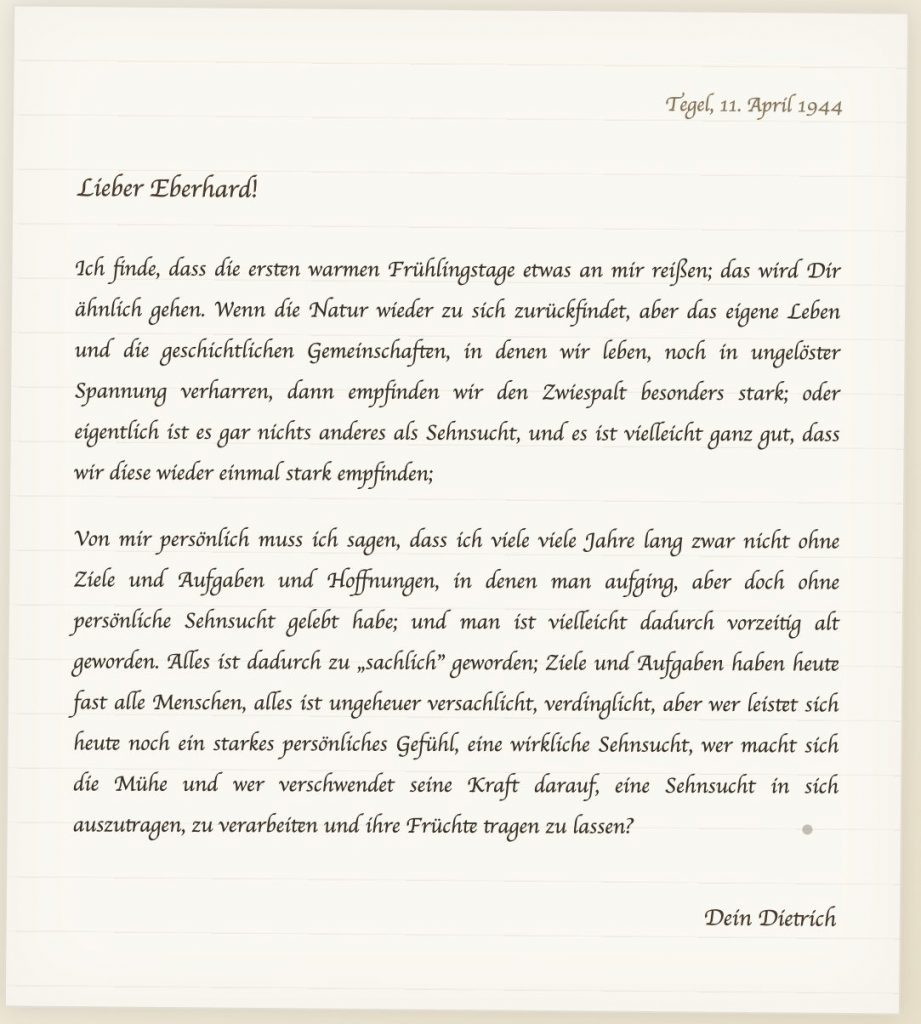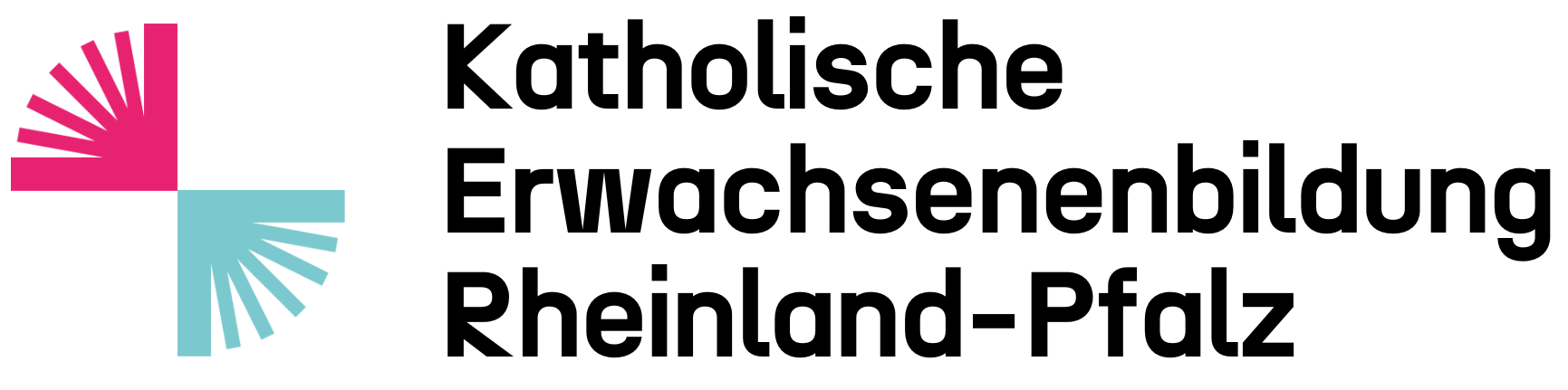Der Begriff Sehnsucht spielt in der politischen Bildung bislang kaum eine Rolle. Doch ein genauerer Blick zeigt: Sehnsucht ist sehr unpolitisch. Sie verweist auf Erfahrungen des Mangels, auf das, was Menschen vermissen, was sie erwarten, was sie sich wünschen. Aus dieser Perspektive wird sie zu einem Ausdruck gesellschaftlicher Spannungen und kultureller Brüche. Wer sich mit Sehnsucht beschäftigt, stellt Fragen an die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft.
Ein Soziologe, der dafür einen wichtigen theoretischen Zugang eröffnet hat, ist Leo Löwenthal.
Löwenthal und das kulturelle Unbehagen
Leo Löwenthal, geboren 1900 in Frankfurt am Main, emigrierte 1934 in die USA und wirkte dort bis zu seinem Tod 1993 als Soziologe und Kulturkritiker. Als Mitglied der Frankfurter Schule entwickelte er in den 1940er bis 1960er Jahren eine präzise Analyse populärer Kultur.
Er betrachtete populäre Erzählungen, Biografien, Romane und Hörspiele nicht als bloße Unterhaltung. Für ihn sind sie Ausdruck gesellschaftlicher Formationen. Sie zeigen, wie sich Sehnsüchte, Ängste und Deutungsmuster innerhalb einer Gesellschaft verdichten und formieren. Löwenthal untersuchte die Struktur solcher Texte mit dem Ziel, ideologische Mechanismen sichtbar zu machen.
Für die politische Bildung ist dieser Zugriff von Bedeutung. Denn Löwenthal macht deutlich, dass sich politische Erfahrungen nicht nur in expliziten Stellungnahmen oder in institutionellen Kontexten artikulieren, sondern auch in den scheinbar beiläufigen Formen des Alltags, im Kino, in der Unterhaltungsliteratur, heute vielleicht auf TikTok oder in Streaming-Plots.
Ein zentrales Beispiel ist Löwenthals Bezug zu Schillers Begriff des ästhetischen Publikums. Er schreibt:
„Die Menschen nehmen ihren Platz vor dem Vorhang ein mit einer unausgesprochenen Sehnsucht, mit einer vielgestaltigen Fähigkeit.“
(Löwenthal, 1961, S. 44)
Diese „unausgesprochene Sehnsucht“ begreift Löwenthal als eine kulturell geformte Erwartungshaltung. Das Publikum will mehr als Zerstreuung. Es sucht Bedeutung, Orientierung, Anschluss. Gerade weil die gesellschaftliche Realität das nicht immer bietet, entfalten Ersatzangebote ihre Wirkung. Hier setzt Löwenthals Kritik ein. Die Kulturindustrie fängt solche Wünsche ab, bindet sie an Erzählmuster und verspricht Erfüllung, liefert aber keine Veränderung.
Diese Dynamik lässt sich besonders deutlich in heutigen Social Media-Phänomenen beobachten. Wenn Menschen auf TikTok nach „authentischen“ Lifestyle-Tipps suchen oder sich in Streaming-Serien über idealisierte Freundschaften und Karrierewege definieren, artikuliert sich darin dieselbe „unausgesprochene Sehnsucht“, die Löwenthal beschrieb. Plattformen wie Instagram oder YouTube funktionieren als zeitgenössische Kulturindustrieindem sie Teilhabe und Beziehung, Sichtbarkeit und Selbstverwirklichung versprechen, kanalisieren diese Bedürfnisse aber in Konsumverhalten und Aufmerksamkeitsökonomie.
Die politische Bildung kann hier anknüpfen, indem sie diese digitalen Sehnsüchte nicht moralisiert, sondern als Ausdruck struktureller Defizite ernst nimmt: Warum suchen Menschen online nach Gemeinschaft? Was fehlt in realen Partizipationsmöglichkeiten? Löwenthals Ansatz lehrt uns, in viralen Trends und Influencer-Narrativen die Seismogramme gesellschaftlicher Spannungen zu lesen und daraus Ansatzpunkte für demokratische Bildungsprozesse zu entwickeln, die echte Handlungsräume eröffnen.
Sehnsucht, Verlangen und politische Relevanz
Löwenthal spricht selten explizit von Sehnsucht. Häufiger verwendet er Begriffe wie desire (Verlangen, Begehren), yearning, (sehnsüchtiges Verlangen), aspiration (Streben). Diese Begriffe markieren Formen des Verlangens, die gesellschaftlich strukturiert sind. Sie entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern innerhalb bestehender Machtverhältnisse.
Ein Beispiel ist seine Auseinandersetzung mit massenkulturellem Sensationalismus. Dort fragt er:
„Können wir verhindern, dass dieses Verlangen nach Sensation zum Ersatz für politisches Verständnis wird?“
(Löwenthal, 1961, S. 105)
Auch an anderer Stelle macht er deutlich, wie kulturelle Bedürfnisse mit demokratischer Bildung kollidieren können:
„Das Verlangen der Öffentlichkeit nach Neuem wurde schon lange als Feind der konzentrierten Aufmerksamkeit erkannt, die für staatsbürgerliche Bildung notwendig ist.“
(Löwenthal, 1961, S. 114)
In beiden Fällen steht das Begehren im Zentrum der Analyse. Löwenthal fragt nicht nur, was Menschen wollen, sondern auch, wie ihre Wünsche gelenkt werden und welche gesellschaftlcihen und politischen Folgen das hat.
Vier Impulse für eine politische Bildung, die Sehnsüchte ernst nimmt
Löwenthals kulturkritischer Zugang lässt sich in vier pädagogische Perspektiven übersetzen, die für eine politische Bildung der Gegenwart anschlussfähig sind:
Erstens: Populärkultur kann als Ausdruck gesellschaftlicher Spannungen gelesen werden. Serien, Songs, Influencerformate transportieren nicht nur Inhalte, sondern auch Bilder von Ordnung, Macht und Zugehörigkeit. Politische Bildung kann helfen, diese Bedeutungen zu entschlüsseln, ohne sie vorschnell zu bewerten.
Zweitens: Sehnsüchte sind keine Defekte. Sie sind Reaktionen auf gesellschaftliche Leerstelle, auf mangelnde Repräsentation, Ausschluss, Unsichtbarkeit. Sie zeigen an, wo Teilhabe nicht gelingt, Menschen nichtgesehen werden. Politische Bildung kann hier ansetzen, indem sie diese affektiven Erfahrungen nicht pathologisiert, sondern kontextualisiert und diskursiv entschlüsselt.
Drittens: Nicht alle Sehnsüchte haben emanzipatorisches Potenzial. Regressive Sehnsuchtsmuster, die etwa in autoritären Bewegungen, Verschwörungsmythen oder nationalistischen Narrativen münden, zeigen, wie leicht Begehren politisch instrumentalisiert werden kann. Politische Bildung muss dazu beitragen, solche Dynamiken zu erkennen und Alternativen zu entwickeln.
Viertens: Sehnsucht kann auch utopisch gelesen werden. Wer sich nach einer anderen Gesellschaft sehnt, stellt kritische Fragen. Die Fähigkeit, sich Alternativen zum Hier und Jetzt und für ein besseres Morgen vorzustellen, ist eine politische Kompetenz. Bildung, die solche Imaginationen zulässt und fördert, trägt zur Demokratiefähigkeit bei.
Referenzen
Löwenthal, L. (1961). Literature, popular culture, and society. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Löwenthal, L. (1964). Literatur und Massenkultur. Neuwied: Luchterhand.
Löwenthal, L. (1971). Falsche Propheten: Studien zur faschistischen Agitation. Frankfurt am Main: Suhrkamp.